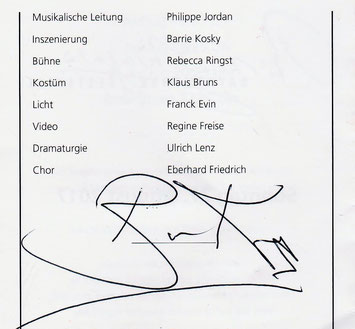
Endlich gibt es am Grünen Hügel wieder eine Produktion, der man beglückt Festspielniveau auf allen Ebenen bescheinigen kann, wofür zuletzt (mit wechselnden Dirigenten) die „Parsifal“-Inszenierung von Stefan Herheim aus dem Jahr 2008 und die „Lohengrin“-Inszenierung von Hans Neuenfels aus dem Jahr 2010 standen. Die würdige Nachfolge ist Barrie Kosky und Philippe Jordan geglückt: Es ist seit den Neubayreuther Interpretationen von Wagnerenkel Wieland Wagner 1956 (mit dem schwebenden Holunderkugelbaum) und 1963 (die auf einer Shakespearebühne spielte) die erste Produktion dieses Werks im Festspielhaus von theatergeschichtlichem Rang. Und sie geht mehr noch erstmals in Bayreuth auf ernst zu nehmende Weise der besonders schwierigen Rezeptionsgeschichte nicht aus dem Weg. Im Gegenteil: Dass „Die Meistersinger von Nürnberg“ im Nazi-Deutschland zur Reichsparteitagsoper avancierten und als Durchhalteoper bei den Festspielen sogar noch 1944 gegeben wurden, wird hier schon durch das gelungene Bühnenbild (Rebecca Ringst) thematisiert. Richard Wagners einzige, wenn auch nicht so bezeichnete komische Oper im Bayreuth-Repertoire spielt zwar im 1. Aufzug im Wahnfried-Salon, aber wie im Aktschluss sichtbar wird, auch schon da im Rahmen von jenem Gerichtssaal in Nürnberg, in dem die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg die NS-Kriegsverbrecherprozesse durchführten.
Barrie Kosky (das Autogramm oben stammt vom 27. August) hat sich vor der Premiere selbst in einem Interview mit der New York Times als „schwules jüdisches Känguru“ bezeichnet. Und erklärt, dass er als solches speziell mit den „Meistersingern“, in denen es um deutsche Kunst und deutsche Identität geht, seine Schwierigkeiten haben würde. Dass er – auch weil Festspielintendantin Katharina Wagner ihn nach seiner spontanen Absage bat, diese zu überdenken – die Herausforderung dennoch annahm, liegt an seinem speziellen Zugang: Kosky entdeckte, dass er die Oper konkret durch Wagners Augen sehen konnte, „durch den deformierten, sich selbst widersprechenden, frustrierend komplexen Genius Wagners“. Was wörtlich zu nehmen ist: Wagner als Person ist das Zentrum des Stücks. Und um ihn kreisen jene, die auch real das Haus Wahnfried mit Leben füllten: seine Hunde, Kinder und Frau Cosima, Schwiegervater Franz Liszt, die Dienerschaft – und nicht zuletzt der jüdische Dirigent Hermann Levi.
Der Abend beginnt launisch, mit einigen wie auf einer alten Schreibmaschine getippten Infos zu dem, was die Zuschauer erwartet. Spätestens die Temperaturangabe mit 23 Grad Celsius sorgt für allgemeine Heiterkeit, ganz unabhängig von der real gegebenen Wetterlage. Schon während des Vorspiels rollt eine Szene ab, wie sie sich ähnlich vielfach in Hotels oder Wohnungen Wagners abgespielt hat: Der „Meister“ präsentiert im Familien-, Freundes- und Mitarbeiterkreis eines seiner Werke, sprich: die „Meistersinger“, singt und spielt fast alle Rollen – und ist als Person und als Sängerdarsteller von raumfüllender Ausstrahlung. Was sich unter anderem dadurch ausdrückt, dass es ihn nicht nur einmal gibt, sondern in einigen Haupt- und Nebenversionen: Er ist natürlich Hans Sachs, aber auch Walther von Stolzing, ist sogar David – und wird auch noch von zwei Knaben verkörpert, selbstverständlich mit Wagnerkappe und verfrühtem Backenbart.
Sein erster Auftritt überrumpelt das Publikum: Wagner-Sachs kommt mit den Neufundländern Marke und Molly in den Salon gefegt, gefolgt von einem Dienstmädchen, das hinter den Hunden den Boden wischt. Er überantwortet die Hunde Levi, der einen ersten stillen Kampf ausficht zwischen der Balance seiner Mokkatasse und den an der Leine ziehenden Tieren. Die Wahnfried-Burleske zeigt Cosima mit Migräne und ihren Gatten glücklich beim Auspacken diverser Pakete – als erstes mit den auf die kommende Sachs-Rolle weisenden neuen Schuhen, dann mit kostbaren Stoffen und Parfums sowie dem bekannten Lenbach-Porträt Cosimas. Dass Wagners Schwiegervater aus dem geöffneten Flügel steigt, wundert hier niemanden und ist nur der Anfang. Denn es folgen Stolzing, David, die Kinder – und der Reihe nach klettern oder purzeln in Renaissancekostümen später sogar die Meister aus dem wundersamen Instrument.
Doch zuvor ist ein erstes Stühlerücken angesagt. Die handelnden Personen formieren sich zu einer kleinen Hausandacht, die sich gewaschen hat. Im überwiegend protestantischen Wagnerhaushalt wird zum Katharinenkirchen-Choral aus dem Off brav gebetet – und der königliche Kapellmeister Levi, der für die zweiten Festspiele 1882 ein Muss sein wird, weil König Ludwig II. nur mit ihm zusammen auch das Hofopernorchester für Bayreuth freigibt, lässt sich durch missbilligende Blicke und Gesten Wagners und Abbé Liszts auf die Knie zwingen: die erste große Ausgrenzung an diesem Abend. Barrie Kosky und die zwei überragenden Sängerdarsteller Michael Volle (Wagner/Sachs) und Johannes Martin Kränzle (Levi/Beckmesser) zeigen bereits hier in großer Meisterschaft, dass in dieser Inszenierung beides unter einen Hut gebracht werden kann: Der heitere musikalische Grundcharakter der „Meistersinger“ wird bedient, aber die unangenehmen Implikationen, die sich um das Stück und seinen Komponisten ranken, sind nicht ausgeklammert, sondern werden durchaus schmerzlich thematisiert. Schon diese kleine und doch so große Szene löst etwas aus, das mir bei den »Meistersingern« noch nie passiert ist: Ich habe mich für den Antisemiten und Rassisten Richard Wagner geschämt.
Wagner, wie Michael Volle ihn auf die Bühne bringt, ist ein Tsunami – ein virtuoser Treibauf, mal charismatisch und brillierend, mal nervend und schrecklich selbstgerecht, ein unentwegter Werbespot für sich selbst und sein Werk, aber immer wieder auch der liebenswerte Egomane, dem man wie nicht wenige seiner Zeitgenossen gerne fast alles verzeiht. Eine kleine Szene mit Liszt illustriert das: Wagner, der bekanntlich ein nur mäßiger Klavierspieler war, maßt sich an, dem ihm um Lichtjahre überlegenen Virtuosen zu zeigen, wie er eine bestimmte Stelle zu spielen hat – und der lässt sich das gefallen. Plötzlich versteht man, dass Liszt nicht nur ein außergewöhnlicher Künstler, sondern auch ein außergewöhnlicher Freund war. Umgekehrt sieht man den erfrischend jungen, stets hippeligen Lehrbuben David etwas anders, wenn er als Lehrmeister im Wagnerkostüm die Regeln haarklein und in allen Duftkomponenten zu erklären weiß.
Im Wahnfried-Akt triumphiert das Komödiantische. Der Regisseur macht sich zusammen mit seinem stilsicheren Kostümbildner (Klaus Bruns) einen Spaß daraus, die kleinbürgerliche Gemütlich- und Harmlosigkeit, in der sich schrecklich viele „Meistersinger“-Inszenierungen eingerichtet haben, gekonnt auf die Schippe zu nehmen. Was für ein wunderbarer, buchstäblicher Running Gag sind die Auftritte der Lehrbuben, die wie ein Spuk immer nur in den Salon hereinbrechen, wenn sie etwas zu singen haben. Und wie herrlich sind die individuell gezeichneten, einem Renaissancegemälde entsprungenen Meister, wenn sie – so viel authentische Butzenscheibenromantik möchte auch in Wahnfried sein! – die Blechschachtel mit Lebkuchen herumgehen lassen und unisono mit ihren Löffelchen an die Tasse klopfen, um die Anwesenheitsliste zu bestätigen und den Regularien Tribut zu zollen! Wobei sie im Alltag erkennbar mehr Freiraum zulassen, als sich das im Libretto liest: Der Kupferschmied Hans Folz (Timo Riihonen) ist ganz offensichtlich schwul und pflegt Stolzingwagner anzuhimmeln, als wäre der ein Popstar vom Kaliber eines Michael Jackson.
Stolzing ist kein stolzer, irgendwie abgehobener Ritter, sondern – weil hier ja auch der junge, revolutionäre Richard Wagner in ihm steckt – ein gestandenes Mannsbild mit Humor. Barrie Kosky nutzt dabei, was die meisten seiner Kollegen leider brach liegen lassen, nämlich das komödiantische Talent von Klaus Florian Vogt, der unter anderem ganz herrliche Schnuten und Grimassen ziehen kann und darf. Die Partie konkurrenzlos gut singen kann er ohnehin. Wesentlich distinguierter gibt sich da zunächst Johannes Martin Kränzle als Beckmesser: Das ist ein wohlerzogener Mann, der selbstverständlich stets ein sauberes Taschentuch bei sich trägt, das er nach dem Benutzen akkurat zusammenfaltet, und sein Butterbrot so isst, dass etwaige Krümel garantiert ins sorgfältig ausgebreitete Papier fallen. Das turbulente Ende des 1. Akts gipfelt darin, dass der Wahnfried-Salon sich plötzlich nach hinten bewegt und erstmals erkennbar wird, wo das Stück tatsächlich spielt: nicht um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Nürnberg, sondern 1945/46, im Verhandlungssaal des Internationalen Militärgerichtshofs im Nürnberger Justizpalast.
Der 2. Aufzug beginnt mit einer wiederum getippten Liebeserklärung Wagners an Cosima – und einem bildnerischen Coup: Der mit grünem Kunstrasen ausgelegte, leere Gerichtssaal ist gleichzeitig eine Romantik-Idylle mit der Uhr als Vollmond, eine vorweggenommene Festwiese auch, denn im 3. Akt wird es keine geben – und womöglich ein Sinnbild dafür, dass man nicht nur über die Rezeptionsgeschichte der »Meistersinger« gerne das Gras hat wachsen lassen. Zuerst sieht man Wagner-Sachs und Cosima-Eva beim Picknick, vermutlich in einer paradiesisch sein sollenden Pegnitzaue, wo es keine Pegnitz gibt, dafür mittendrin merkwürdigerweise eine Art Rednerpult steht – oder ist es ein Zeugenstand? Später kommen noch ein Lehnstuhl und ein Fußbänkchen dazu – und fertig ist die Schusterstube. Alles wirkt improvisiert und bedient doch genau die Handlung. Ausgerechnet in diesem doppelbödigen Kunstraum, dessen tieferer Sinn sich beim ersten Sehen nicht unmittelbar erschließt, funktioniert übrigens endlich einmal, dass die Stimmen von Eva und Stolzing, wenn sie sich vor den anderen vor, neben und hinter dem Pult, in den riesigen blauen Vorhängen auf der rechten Seite oder hinter dem Cosima-Gemälde verstecken, sinnfällig und gut zu hören sind. Ein Beispiel dafür, wie hier auch musikalisch ungemein delikat gearbeitet wird.
Es ist ein Spiel im Spiel im Spiel. Stolzing spart seinen Zorn nicht und sticht mit seiner Waffe heftig auf einen der umhergeisternden Musikanten ein, so dass der scheinbar tödlich getroffen zu Boden sinkt, aber flugs wieder aufsteht und entschwindet. Es gehört zu diesem spannenden Abend, dass die Spielebenen manchmal so verschwimmen, dass man nicht immer weiß, wann was wo passiert und warum und trotzdem den Eindruck hat, dass alles authentisch wirkt und dramaturgisch stimmt. Und alles geschieht mit einer Selbstverständlichkeit und »Natürlichkeit«, dass man die Handlung trotz ihres doppelten Bodens gern für bare Münze nimmt. Auf den ersten nächtlichen Spuk mit den Musikanten folgt die Prügelszene – mit Bildern, die niemand vergessen kann.
Der Rasen, der über manches gewachsen ist, wird hochgezogen und darunter tut sich der Abgrund auf, den keiner von sich aus unmittelbar mit der „Meistersinge“«-Prügelszene in Verbindung bringen würde und den auch nur ein Regisseur so weit öffnen kann, der aus einer jüdischen Familie stammt: Dass der im Wahnfried-Prolog als Hermann Levi eingeführte Beckmesser ein Jude ist, wird jetzt noch schmerzlicher deutlich. Plötzlich rast die Uhr rückwärts und Beckmesser wird (dezidiert unter dem Wagner-Porträt von Cäsar Willich aus der Entstehungszeit der „Meistersinger“) zusammengeschlagen und gedemütigt, wie es die Nazis hundert-, tausend- und millionenfach in Deutschland getan haben. Er bekommt eine riesige Maske aufgesetzt, die eine Judenkaritatur zeigt, die aus dem „Stürmer“ des fränkischen NS-Gauleiters Julius Streicher stammen könnte. Die Maske ist so schwer, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann und deshalb einen merkwürdigen Tanz absolviert, der ihn gleich noch mehr zur Karikatur macht. Der Alptraum hat aber noch kein Ende. Über dem Pult bläht sich fast in Bühnenhöhe eine noch viel größere Judenfratze auf, unter der Beckmesser fast ganz verschwindet. Gespenstisch schnell verflüchtigt sich das Volk, nur Sachs bleibt hinten in der Ecke stehen und sieht betroffen zu, wie der Ballonkopf langsam in sich zusammensinkt und sich dem Publikum zu den zartesten Sommernachtsklängen schließlich nur noch die Kippa mit dem Davidstern zeigt.
Beim ersten Sehen – nicht im Festspielhaus, sondern im Livestream des Bayerischen Rundfunks – fand ich die Verdoppelung und Vergrößerung der Judenkarikatur noch übertrieben. Das hat sich bei meinen folgenden fünf (!) Besuchen von „Meistersinger“-Vorstellungen in Bayreuth schnell geändert. Die Wirkung der Prügelszene ist richtigerweise drastisch, wenn man den Ansatz des Regisseurs ernst nimmt. Hier – und nur hier – greift Barrie Kosky zum Holzhammer, wählt ein Bild, das deutlich macht, wohin rassistische Ausgrenzung geführt hat und immer wieder führen kann, wenn eine Gesellschaft nicht aufpasst, die Warnzeichen übersieht und Populisten nachläuft. Auch während dieser Szene habe ich mich zutiefst geschämt – nicht über Wagner, sondern über meine Vorfahren, über die Deutschen, über „mein“ Volk, das derlei nicht nur zugelassen, sondern mehrheitlich auf allen Ebenen mitgetragen hat – wie das „Meistersinger“-Volk auf der Bühne.
Bevor der 3. Aufzug beginnt, verpasst der Regisseur dem Publikum gleich noch eine bittere Pille. Die Texteinblendung berichtet vom größten britischen Luftangriff auf Nürnberg am 2. Januar 1945 und davon, dass deutsche Abfangjäger die Bomber mit einer neuen Waffentechnik mit dem Codenamen „Schräge Nachtmusik“ bekämpften. Gleich nochmals habe ich mich geschämt, denn dieser Text zielt auf den Reflex, Nazis nur als ungebildete, kulturlose Rohlinge sehen zu wollen. Nein, die Täter waren auch Musik-, Opern-, Theater- und Kunstliebhaber.
Der Schusterstuben- und Festwiesenakt spielt vollends im jetzt komplett möblierten Gerichtssaal. Vorne links sitzt nachdenklich an einem improvisierten Esstisch Sachs, der von David (sängerdarstellerisch sensationell: Daniel Behle), der menschlichen Inkarnation des singenden und springenden Löweneckerchens, aufgeschreckt wird und einen traurig bitteren und liebevollen Wahn-Monolog singt, der einem die Tränen in die Augen treibt. Vollauf zu preisen ist auch die zweite Szene: Endlich darf das Publikum sehen, dass selbst ein genialer Dichterkomponist erst einmal nachdenken muss, bevor er zu seiner Morgentraumdeutweise anheben kann, darf miterleben, dass er sie eben gerade erst erfindet und dafür Zeit braucht. Auch das ist ein Musterbeispiel für die überaus gelungene und differenzierte musikalische Interpretation, die ohne den mit der Regie mitdenkenden und sie tragenden Dirigenten nicht möglich wäre.
Wie schon im 2. Aufzug ist die Szene Beckmesser-Sachs ein Höhepunkt des an Höhepunkten weiß Gott nicht armen Abends. Beckmesser, den einen Arm in einer Schlinge, die lädierten Finger der anderen Hand verbunden, kommt nicht gebückt herein, sondern quert den Saal in tadelloser Haltung, kerzengerade und stocksteif, wie ein tadellos assimilierter jüdischer Lehrer oder Offizier anno dazumal. Die Musik bringt ihn dazu, das Trauma der vorangegangenen Nacht noch einmal zu durchleben – was diesmal die ihn bedrängenden zwergenhaften Schtetl-Juden nur noch verstärken. Johannes Martin Kränzle ist ein intelligenter und souveräner Sängerdarsteller, der den Mut hat, auch ein den rassistischen Klischees entsprechender Beckmesser zu sein, der sabbelt, zappelt, sich zunehmend verrennt, kiekst und Kauderwelsch von sich gibt – und seinen Spitzenton verfehlt (den er selbstverständlich drauf hat). Ähnlich intensive Sängerleistungen habe ich seit dem legendären Chéreau-„Ring“ in Bayreuth nicht mehr erlebt.
Gleiches gilt für Michael Volle, der sich bei der Vorstellung am 7. August vor dem 3. Aufzug ansagen lassen musste und die Mammutpartie mit bewundernswerter Professionalität ökonomisch so geschickt meisterte, dass das Gros des Publikums die nicht unerhebliche Indisposition gar nicht bemerkte. Auch in den noch folgenden Vorstellungen sparte Volle an den richtigen Stellen ein bisschen und so gekonnt, dass das nur sehr feinen Ohren auffallen konnte. Sein Bayreuther Sachs ist phänomenal. Überhaupt ist es das große Glück dieser Produktion, dass die Hauptrollen Sachs, Beckmesser, Stolzing und David mit Sängern besetzt werden konnten, die im Zenit ihrer großen Kunst sind, gerade auch in diesen Partien. Durch den tieferen, sehr weit reichenden Sinn, den die Inszenierung schafft, ist es vermutlich auch für die Solisten selbst eine Art Vollendung. Besser kann man das nicht machen, nur anders. Wagner selbst wäre begeistert gewesen: Von Sängerdarstellern dieses Kalibers hat er sein Leben lang geträumt.
Unter den weiteren Hauptsolisten sind neben Günther Groissböck als Liszt und Pogner sowie Wiebke Lehmkuhls Magdalene hervorragend. Dass bei den größeren Rollen einzig Anne Schwanewilms als Eva und Cosima von vornherein mit Abstrichen gewertet werden muss, hat mehrere Gründe. Die versierte Wagner- und Strauss-Sängerin lehnte die Partie zunächst ab, was man aus Altersgründen gut nachvollziehen kann. Wie könnte sie auf Dauer Eva glaubwürdig verkörpern, wenn sie reduziert wird auf ein ungeduldiges, zappliges junges Ding? Dass Barrie Kosky genau das wollte, lässt darauf schließen, dass er in diesem Punkt die Folgen seines Konzepts (Dramaturgie: Ulrich Lenz) nicht absehen konnte oder wollte. Anders als die Figurendoppelungen bei den männlichen Hauptfiguren geht die Gleichung Eva = Cosima nicht so überzeugend auf. Im Gegenteil: Dadurch, dass Anne Schwanewilms zumindest bei den ersten zwei Vorstellungen nicht gut bei Stimme war (was leider nicht angesagt wurde), fühlte die Sängerin sich doppelt unsicher und unwohl in der Rolle, wurde sogar ausgebuht – und das ist ein Unding! Wer Sänger buht, hat schlichtweg keine Ahnung davon, was Operngesang ist, nämlich körperliches und geistiges Multitasking auf höchstem Konzentrationsniveau bei gleichzeitig größtmöglicher Lockerheit, wobei schon kleinste Beeinträchtigungen des Stimmapparats sich dramatisch auswirken können.
Der negative Beigeschmack bei der allzu schematischen Eva-Cosima-Figur bleibt, zumal auch der Tanz von David und den zwei Mini-Wagners um das Cosima-Bildnis in der Festwiese aufgesetzt wirkt. Was soll uns das sagen? Dass die „hohe Frau“ sich selber anbetungswürdig fand und womöglich die schlimmere Antisemitin war? Vielleicht war sie das, aber sie hat sehr viel länger gelebt als ihr Göttergatte R. und hatte das Pech, zuletzt in Oliver Hilmes einen meinungsbildenden Biografen zu haben, der leider nur zu gerne in gängige Schubladen greift und diese vielschichtige Frau viel zu einseitig präsentiert. An Eva-Cosima könnte Barrie Kosky nachbessern. Das ist er der Sängerin ebenso schuldig wie der Figur. Und der sonst so virtuose Beleuchter Franck Evin darf noch das Licht korrigieren, das im 2. und 3. Aufzug nicht ganz korrekt aus den hohen Fenstern rechts fällt.
Und noch ein Werkstatt-Auftrag: So brillant der Regisseur sonst auch große Menschenmengen zu führen weiß und blitzartig auftauchen und verschwinden lassen kann, für die Festwiesenszene reicht es eben nicht aus, die heftig bewegten Massen immer wieder einzufrieren und dann wieder Fahnen schwenkend herumtoben zu lassen. Immerhin gibt es auch hier Stoff zum Nachdenken: Wenn die einzelnen Meister einmarschieren, werden sie vom Volk applaudiert und bejubelt wie in einer Fernsehshow. Nur bei Beckmesser rührt sich keine Hand. Die Ausgrenzung geht weiter, wird von Männern und Frauen gleichermaßen gnadenlos praktiziert und wird nicht aufgehoben. Nach seinem verpatzten Auftritt wird der Merker von zwei Choristen gepackt und ziemlich unfreundlich durch die kleine Nebentür rechts nach draußen abgeschoben.
Es ist ein toller Kunstgriff, dass Sachsens Schlussansprache im leeren Gerichtssaal stattfindet. Das Volk, die Musikanten und Fahnenträger, die Meister mit Pogner und Kothner, Eva, Stolzing, David und Magdalene: Sie sind alle weg. Was Wagner-Sachs zu sagen hat, richtet er, wie es der Komponist ursprünglich und in einer kürzeren Version vorgesehen hatte, direkt und nur ans Publikum – zuerst von diesem schnörkellos einfachen Pult aus, das eher ein Zeugenstand ist, aber auch eine Anklagebank sein kann. Wenn Barrie Kosky dann ganz real die Musik sprechen lässt, indem er für den dann dirigierenden Wagner ein Orchester samt Chor hereinfahren lässt, obliegt es den Zuschauern selbst zu urteilen, was sie davon halten und ob C-Dur einfach C-Dur ist oder nicht doch auch Erkenntnisse und Eintrübungen mit schwingen und hörbar werden können. Wie auch immer: Das ist kein „Freispruch für Wagner“, wie es auf der relaunchten Website der Festspiele ein Mitarbeiter des Pressebüros am 25. Juli 2017 titelte und unter anderem schrieb: „Auf den Tischen von Richtern, Verteidigung und Anklage tanzt sich das Volk seinen Wagner aus den Anklageakten zurück.“ Eigentlich müsste Barrie Kosky sich von diesem, seine offene Lösung desavouierenden Text der Festspiele distanzieren.
Und die Musik? Natürlich ist sie atemberaubend schön, und ja: Sie kann einen zwar zuweilen traurig, aber vor allem glücklich machen. Womit noch angesprochen sei, dass Philippe Jordan, das Festspielorchester und der von Eberhard Friedrich einstudierte Festspielchor schon bei der Premiere eine gute Gesamtleistung abgegeben haben, aber mit jeder Vorstellung noch ein bisschen besser geworden sind. Das ist normal bei einer Neuproduktion, die immer noch ein paar Proben mehr brauchen könnte. Der Ansatz des Dirigenten ist klar: Es geht ihm um einen transparenten, spielerisch leichten Klang, darum, dass die Sänger auf diesem sehr differenziert gewebten, mitnichten pathosschweren, sondern seidenleichten Klangteppich singen können, als ob sie sprächen. Und tatsächlich kommen in dieser Interpretation sogar die kleinen Meister besser über die Rampe als sonst, nicht nur, weil jeder darstellerisch ein ausgefeiltes Individuum ist, sondern auch stimmlich – solo und in den Ensembles. Das Tempo ist zügig, aber nirgends zu schnell, und nur wer die Aufführung nicht sieht, dürfte über die szenisch bedingten, vom Komponisten so nicht vorgesehenen überlangen Generalpausen irritiert sein.
Es bleibt zu wünschen, dass die Festspielleitung dafür sorgt, dass Philippe Jordan und möglichst alle Solisten der Produktion so lange wie möglich erhalten bleiben, damit wenigstens bei den „Meistersingern“ auf Jahre hinaus das ursprünglich einstudierte Ensemble zusammen bleibt und sich noch kontinuierlich steigern und verfeinern kann. Katharina Wagner sollte sich darauf besinnen, dass es genau das war, was früher viele Festspielproduktionen ganz unabhängig vom Stil der Inszenierung wirklich zu etwas Besonderem machte. Schon die Steigerung, die ich von der zweiten bis zur sechsten Vorstellung erleben konnte (bei der letzteren war übrigens Barrie Kosky dabei, was sich unmittelbar auf die Spielfreunde der Mitwirkenden auswirkte), sagt mir, dass diese „Meistersinger“ dem Publikum noch viele bewegende, sublime und unvergessliche Musiktheatererlebnisse bescheren könnten.
Nachtrag 1: Beim Gang durch die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin Ende August stoße ich auf eine Projektionswand, wo gerade ein Film abläuft, der unter anderem das bombardierte Nürnberg zeigt. Sofort steigt in meiner Erinnerung der Wahn-Monolog des Hans Sachs mit Michael Volle vor mir auf. Zu den schrecklichen Bildern höre ich im Kopf sein „Wie friedsam treuer Sitten, getrost in Tat und Werk, liegt nicht in Deutschlands Mitten mein liebes Nürenberg!“, sehe ihn die Arme ausbreiten und ich fange an zu weinen. Ach, Wagners schön gedachte Stadt- und Kunstbürger-Utopie!
Nachtrag 2: Festspielkarten für 2018 habe ich bereits bestellt. Aus Neugier natürlich auch die „Lohengrin“-Neuinszenierung, vor allem aber die „Meistersinger“, von denen ich einfach nicht genug kriegen kann in ihrer unvergleichlichen Mischung von schmerzlicher Bitterkeit und musikalischer Glückseligkeit. Und weil gerade Oktoberfest ist, gebe ich schnell noch meinen Senf zu dem in mehrfacher Hinsicht abartigen „Walküre“-Projekt der Festspiele. Es ist schon deshalb abartig, weil Richard Wagner bekanntlich seine Tetralogie nur als geschlossenes Ganzes aufgeführt haben wollte und gegen Einzelaufführungen von „Ring“-Werken, wie sie ihr Finanzier König Ludwig II. durchsetzen konnte, aus guten Gründen Himmel und Hölle in Bewegung setzte. Dass in seinem eigens für die „Ring“-Aufführung gebauten Festspielhaus jetzt eine einzelne „Walküre“ auf den Spielplan kommt, sollte gewichtige Gründe haben. Die Tatsache, dass der ehemalige Startenor Plácido Domingo auf seine alten Tage jetzt auch noch als Festspieldirigent in die Annalen eingehen möchte, kann es allein nicht sein. Sein Ruhm als Dirigent nimmt sich eher bescheiden aus, die Entscheidung für dieses Projekt kann also nicht auf künstlerischen Gründen fußen. Worauf dann? Während Manuel Brug in der Tageszeitung „Die Welt“ zu Festspielbeginn schrieb, dieses Engagement habe noch Eva Wagner-Pasquier zu verantworten (die von 2008 bis 2015 gemeinsam mit ihrer Halbschwester Katharina Wagner Festspielintendantin war), erklärte Horst Eggers, Präsident des Richard-Wagner-Verbands International, mir bei einem Empfang der Festspielleitung für die Wagnerverbände am 15. August 2017, dass es noch Wagnerenkel Wolfgang Wagner (1919–2010) gewesen sei, der Domingo ein Dirigat versprochen habe. Das mag glauben, wer will – überprüfen lässt sich das sowieso nicht mehr. Ich vermute eher, dass es sein könnte wie auf dem Oktoberfest, wo Möchtegerndirigenten für ihren großen Auftritt vor dem Blasorchester eine nette Summe springen lassen. Auf der Vermarktungsschiene ließe sich das Geld dann locker wieder reinholen, denn natürlich würden all die enttäuschten Domingo-Fans, die ihm trotz des teuren Bayreuth-Trips beim Dirigieren eben nicht zuschauen können, anschließend gerne die DVD mit Bildern aus dem Orchestergraben kaufen.
Nachtrag 3: Nichts gegen die Vermarktung von Festspielaufführungen! Man kann die Premieren-Vorstellung noch bis Jahresende beim Bayerischen Rundfunk abrufen: http://www.br.de/mediathek/video/video/20170725-wagner-meistersinger-bayreuther-festspiele-konzert-video-102.html#&time;=00-04-38
Besuchte Vorstellungen am 31. Juli sowie 7., 15., 19. und 27. August
Ähnliche Beiträge
- Ein szenischer Geniestreich 30. Juli 2018
- Michael Volle, der Jahrhundert-Sachs 28. Juli 2019
- Kein guter Tag für Beckmesser 1. August 2021
- Mehrfach kostenlose „Meistersinger“ 15. Juli 2017
- Bayreuther „Meistersinger“ sind die Aufführung des Jahres 28. September 2018
